![Hallo [hallo]](./images/smilies/hallo.gif)
Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Ist mir Wurst, für mich sind die beiden Bauwerke ein derartig lächerlicher Mist, könnten auch in Las Vegas oder in Disney Paris stehen. Und für andere soll es der Palast sein. ![Hallo [hallo]](./images/smilies/hallo.gif)
![Hallo [hallo]](./images/smilies/hallo.gif)
Laie, Experte,Dilettant
(alle Fachrichtungen)
(alle Fachrichtungen)
-

karnak - Beiträge: 28884
- Bilder: 0
- Registriert: 5. Februar 2012, 13:18
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Nostalgiker hat geschrieben:Die Kirche in Barcelona, die du dämlich und lächerlich findest, ist das hervorragende und bekannteste Bauwerk von Antoni Gaudi, einem führenden Vertreter des katalanischen Modernisme; einer Spielart des Jugendstils.
Weder der Jugendstil noch der Modernisme muß einem zusagen aber ihn als dämlich und lächerlich zu bezeichnen geht doch ein wenig zu weit.
Anders das Schloß Neuschwanstein, es gilt als das Hauptwerk des Historismus.
Es ist in seiner romantisierender Form, wie stelle ich mir eine mittelalterliche Burg vor, unglaublich kitschig aber es hat was. Die umliegende Landschaft ist ähnlich kitschig und aus diesem Blickwinkel passt es schon.
Der Palast der Republik war eher der neuen Sachlichkeit zuzuordnen, klare Linien, viel Glas.
PS.: Übrigens dient das Schloß Neuschwanstein einem weltweit agierendem Unterhaltungskonzert als nachempfundenes Symbol seiner weltweit verstreuten Freizeit- und Erlebnisparks.
Er versteht es nicht. Ach und sicher ist Konzern gemeint...passiert
*Dos Rauschen in Wald hot mir'sch ageta, deß ich mei Haamit net loßen ka!* *Zieht aah dorch onnern Arzgebirg der Grenzgrobn wie ene Kett, der Grenzgrobn taalt de Länder ei, ober onnere Herzen net!* *Waar sei Volk verläßt, daar is net wert, deß'r rümlaaft of daaner Erd!*
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
-

pentium - Beiträge: 53409
- Bilder: 156
- Registriert: 9. Juli 2012, 16:12
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Zu besonderen Bauwerken. Schon mal in einer Pyramide übernachtet? Nein, nicht in Ägypten... ![Schockiert [shocked]](./images/smilies/shocked.gif)
AZ
![Schockiert [shocked]](./images/smilies/shocked.gif)
AZ
"Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist."
„Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war“.
"Es ist manchmal gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. (Voltaire)"
„Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war“.
"Es ist manchmal gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. (Voltaire)"
-

augenzeuge - Flucht und Ausreise

- Beiträge: 95253
- Bilder: 20
- Registriert: 22. April 2010, 07:29
- Wohnort: Nordrhein-Westfalen
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Der "Ballast" der Republik ![Gluecklich [grins]](./images/smilies/grins.gif)
Ein Video über den Bau (1973-1976) und Infos über das ökonomische Chaos....
AZ
![Gluecklich [grins]](./images/smilies/grins.gif)
Ein Video über den Bau (1973-1976) und Infos über das ökonomische Chaos....
AZ
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
"Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist."
„Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war“.
"Es ist manchmal gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. (Voltaire)"
„Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war“.
"Es ist manchmal gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. (Voltaire)"
-

augenzeuge - Flucht und Ausreise

- Beiträge: 95253
- Bilder: 20
- Registriert: 22. April 2010, 07:29
- Wohnort: Nordrhein-Westfalen
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
// Ein sachlicher Bericht auf RBB24 zu einem emotionalen Stadtgespräch //
Wie zu erwarten war, löst unsere Ausstellung zum Palast der Republik im Humboldt Forum im Berliner Schloss kontroverse Reaktionen aus. Das ist kein Wunder, steht doch das wiederaufgebaute Schloss an der Stelle, wo zuvor der DDR-Bau stand. Dass die Ausstellung ein Zeichen der Wertschätzung und ein Diskussionsangebot sein soll, geht aus diesem Beitrag hervor.
https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/202 ... riss-.html
Mehr als 30 Jahre nach der Wende wird immer noch heiß diskutiert: Hätte man den Palast der Republik abreißen sollen oder nicht? Jetzt widmet das Humboldt Forum dem Palast einen ganzjährigen Themenschwerpunkt.
https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/202 ... ktion.html
Wie zu erwarten war, löst unsere Ausstellung zum Palast der Republik im Humboldt Forum im Berliner Schloss kontroverse Reaktionen aus. Das ist kein Wunder, steht doch das wiederaufgebaute Schloss an der Stelle, wo zuvor der DDR-Bau stand. Dass die Ausstellung ein Zeichen der Wertschätzung und ein Diskussionsangebot sein soll, geht aus diesem Beitrag hervor.
https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/202 ... riss-.html
Mehr als 30 Jahre nach der Wende wird immer noch heiß diskutiert: Hätte man den Palast der Republik abreißen sollen oder nicht? Jetzt widmet das Humboldt Forum dem Palast einen ganzjährigen Themenschwerpunkt.
https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/202 ... ktion.html
*Dos Rauschen in Wald hot mir'sch ageta, deß ich mei Haamit net loßen ka!* *Zieht aah dorch onnern Arzgebirg der Grenzgrobn wie ene Kett, der Grenzgrobn taalt de Länder ei, ober onnere Herzen net!* *Waar sei Volk verläßt, daar is net wert, deß'r rümlaaft of daaner Erd!*
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
-

pentium - Beiträge: 53409
- Bilder: 156
- Registriert: 9. Juli 2012, 16:12
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Berlin - DDR-Geschichte. Die große Sonderausstellung „Hin und Weg. Der Palast der Republik ist Gegenwart“ ist lange zu sehen: Eröffnet im Humboldt-Forum in Berlin im Mai, läuft sie bis zum 16. Februar 2025. Mittels Theaterformaten, Virtual Reality und vielem mehr sollen die Palastgeschichte und auch die Vorgeschichte und Bedeutung des zuvor dort stehenden und dann wieder aufgebauten Schlosses diskutiert und verschiedene Perspektiven zu den umstrittenen Repräsentationsbauwerken vermittelt werden.
Von der SED-Führung zum „Haus des Volkes“ verklärt, wurde der Palast der Republik von diesem gerne witzelnd als „Erichs Lampenladen“ bezeichnet, wegen der vielen Lampen im Foyer. „Diese können im Museumsshop des Humboldt-Forums käuflich erworben werden“, sagte ein Schauspieler beim Theaterspektakel „Bau Auf! Bau Ab!“, Teil des Programms zur Palastgeschichte. Der Satz - vom Darsteller in werbetauglichem Tonfall vorgetragen – löste Gelächter und Raunen beim Publikum aus, weil er auf den Punkt bringt, dass hier etwas als Kitsch, als Souvenir angeboten wird, das eigentlich unschätzbar ist und unverkäuflich. Als Kitsch hält besser das Humboldt-Forum her – mit seinem nur äußerlich barocken Anschein. „Der Palast steckt dem Humboldt-Forum in den Knochen“, bemerkt der Generalintendant des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgerloh, zur Pressekonferenz.
Der Palast der Republik wurde zwischen 1973 und 1976 als repräsentativ-sozialistisches Staats- und Kulturhaus in zentralster Lage auf der Museumsinsel an der Stelle erbaut, an der das ehemalige Berliner Schloss stand. Dieses wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und 1950 auf Veranlassung von Walter Ulbricht abgerissen. Der Palast war Sitz der Volkskammer, Begegnungs- und Unterhaltungsort mit Gemäldegalerie, Theater, Restaurants, Diskothek, Bowlingbahn, Post und Telefonzellen. Die SED hielt hier im Mai 1976 ihren neunten Parteitag ab, Udo Lindenberg und Santana traten hier auf, zum 40. Jahrestag der DDR-Staatsgründung am 7. Oktober 1989 versammelten sich Protestler vor dem Palast. Bereits ein Jahr danach, am 10. August 1990, beschloss hier die erste frei gewählte Volkskammer den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD. Und schon einen Monat später, am 19. September, beschloss der Ministerrat der DDR die Schließung des Palasts wegen 5000 Tonnen Spritzasbest, die darin verbaut waren. Kunst und Inventar aus dem Palast wurden gesichert, manches ging verloren, der Abriss wurde 1993 das erste Mal beschlossen. 2006 kamen die Abrissbagger.
Die Stiftung Humboldt-Forum wurde gegründet und der Bau am Schloss begann 2012, das 2020 fertiggestellt wurde. Die Fassade des Schlosses wurde in weiten Teilen originalgetreu nachgebaut. Eben diese sorgte zuletzt wieder für einen Skandal. Nachdem bereits 2021 ein Großspender mit antidemokratischem und antisemitischem Gedankengut aufgedeckt wurde, sollen nun auch die zuletzt auf der Kuppel aufgestellten alttestamentarischen Propheten mit Geld aus rechten Kreisen finanziert worden sein.
Die Spenderproblematik ist nicht der einzige Skandal um das Schloss. Von Anbeginn ist es vor allem mit sich selbst beschäftigt. Es eröffnete, als die Debatte um Raubkunst und ihre Restitution einen neuen Höhepunkt erreichte. Eingezogen ins Schloss sind die Sammlung des Ethnologischen Museums und das Museum für Asiatische Kunst – so präsentierte das Humboldt-Forum eine Sammlung, deren Herkunft zum Teil immer noch fragwürdig ist.
Auch der Programmschwerpunkt zum Palast der Republik rief wieder kritische Stimmen auf den Plan. Wenige Tage vor Eröffnung der Ausstellung meldete sich eine Gruppe um Architekturprofessor Philipp Oswalt zu Wort, die die Ausstellung als „Zynismus“ bezeichnete. Aber was zeigt sie und was will die Ausstellung? Die Schau zeigt in multimedialen Installationen und mit 300 Objekten die Palastgeschichte von der Planung und Errichtung über seine Nutzung als Veranstaltungsort, seine politische Rolle bis hin zum Abriss in Zusammenhang mit der Schlossdebatte. Im ersten Raum werden mit wissenschaftlicher Distanz und aus größerer historischer Perspektive viele Fragen gestellt und vor allem Raum gegeben für Antworten des Publikums.
Besucherinnen und Besucher werden dazu aufgerufen, ihre Meinung auf kupferfarbene Wandplatten zu schreiben, die an die Fassade des Palastes erinnern. Die Wand war bereits nach einer Woche Laufzeit der Ausstellung gut gefüllt. Die Meinungen reichen von „Baut den Palast wieder auf“ bis hin zu „Das Wahrzeichen eines Unrechtsstaates“. Im zweiten Raum ist eine abwechslungsreiche und dichte Schau von Objekten zum und aus dem ehemaligen Palast zu sehen, darunter Baupläne und Modelle, originale Kunstwerke und Einrichtungsgegenstände, Geschirr und Kleidung, Videoaufnahmen und Fotografien.
Präsent ist hier zum Beispiel die „Gläserne Blume“ beziehungsweise noch vorhandene Teile davon; eine Glas-Stahl-Plastik, die zum Markenzeichen des Palastes und einem Treffpunkt wurde. Hier wird sie so präsentiert, wie sie im Depot lagert – in einem Holzrahmen eingefasst; ein Schwenk in die Gegenwart.
Auch Unterhaltungskultur und politische Ereignisse im Zusammenhang mit dem Palast werden in Videoaufnahmen oder auf Plakaten und Fotografien gezeigt. Der zentralste Teil der Ausstellung aber ist eine Foto- und Audioinstallation, die Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen hören lässt, die mit dem Palast zu tun hatten; Mitarbeiter, Besucherinnen, Künstlerinnen und Kreative, auch ehemalige Vertragsarbeiter aus anderen Ländern kommen zu Wort.
Wer eine historisch-chronologische Ausstellung und Ostalgie erwartet, ist in einem DDR-Museum besser aufgehoben. Spielerisch gestaltete, partizipative und durchaus sinnliche Medienformate überwiegen in der Ausstellung im Humboldt-Forum – spannende Fragmente, die die Tiefe der Geschichte erahnen lassen und mehrere Perspektiven eröffnen. Hierfür ist das Projekt des Humboldt-Forums auch zu honorieren; die jahrelange Auseinandersetzung mit Expertinnen und Experten, Forschenden und vielen, vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, um möglichst viele Perspektiven auf den Palast einzubringen.
Und dennoch bleibt auch bei dieser Schau das ungute Gefühl, es handelt sich nur um einen Programmpunkt, ein Souvenir. Denn unter der preußisch-christlichen Kuppel eines Schlosses, das anstelle des Palastes gestellt wurde, dessen „Gegenwart“ aufleben zu lassen, kann nur wie ein Widerspruch in sich wirken. Wohl nur mit einer großen Geste, einer konsequenten und permanenten Umsetzung hätte etwas anderes gelingen können.
Was bleibt von der Auseinandersetzung mit der Palastgeschichte und der Erinnerungsarbeit? „Es ist jetzt unsere Aufgabe, uns zu überlegen, wie es mit den Netzwerken weitergeht“, so Anke Schnabel, eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Wenn das Schloss länger steht als der Palast, ist dafür ja noch etwas Zeit.
Die Ausstellung „Hin und weg. Der Palast der Republik ist Gegenwart“ ist noch bis zum 14. Juli im Berliner Humboldt-Forum zu sehen.
„Baut den Palast wieder auf.“
Ausstellungsbesucher
Freie Presse
Von der SED-Führung zum „Haus des Volkes“ verklärt, wurde der Palast der Republik von diesem gerne witzelnd als „Erichs Lampenladen“ bezeichnet, wegen der vielen Lampen im Foyer. „Diese können im Museumsshop des Humboldt-Forums käuflich erworben werden“, sagte ein Schauspieler beim Theaterspektakel „Bau Auf! Bau Ab!“, Teil des Programms zur Palastgeschichte. Der Satz - vom Darsteller in werbetauglichem Tonfall vorgetragen – löste Gelächter und Raunen beim Publikum aus, weil er auf den Punkt bringt, dass hier etwas als Kitsch, als Souvenir angeboten wird, das eigentlich unschätzbar ist und unverkäuflich. Als Kitsch hält besser das Humboldt-Forum her – mit seinem nur äußerlich barocken Anschein. „Der Palast steckt dem Humboldt-Forum in den Knochen“, bemerkt der Generalintendant des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgerloh, zur Pressekonferenz.
Der Palast der Republik wurde zwischen 1973 und 1976 als repräsentativ-sozialistisches Staats- und Kulturhaus in zentralster Lage auf der Museumsinsel an der Stelle erbaut, an der das ehemalige Berliner Schloss stand. Dieses wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und 1950 auf Veranlassung von Walter Ulbricht abgerissen. Der Palast war Sitz der Volkskammer, Begegnungs- und Unterhaltungsort mit Gemäldegalerie, Theater, Restaurants, Diskothek, Bowlingbahn, Post und Telefonzellen. Die SED hielt hier im Mai 1976 ihren neunten Parteitag ab, Udo Lindenberg und Santana traten hier auf, zum 40. Jahrestag der DDR-Staatsgründung am 7. Oktober 1989 versammelten sich Protestler vor dem Palast. Bereits ein Jahr danach, am 10. August 1990, beschloss hier die erste frei gewählte Volkskammer den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD. Und schon einen Monat später, am 19. September, beschloss der Ministerrat der DDR die Schließung des Palasts wegen 5000 Tonnen Spritzasbest, die darin verbaut waren. Kunst und Inventar aus dem Palast wurden gesichert, manches ging verloren, der Abriss wurde 1993 das erste Mal beschlossen. 2006 kamen die Abrissbagger.
Die Stiftung Humboldt-Forum wurde gegründet und der Bau am Schloss begann 2012, das 2020 fertiggestellt wurde. Die Fassade des Schlosses wurde in weiten Teilen originalgetreu nachgebaut. Eben diese sorgte zuletzt wieder für einen Skandal. Nachdem bereits 2021 ein Großspender mit antidemokratischem und antisemitischem Gedankengut aufgedeckt wurde, sollen nun auch die zuletzt auf der Kuppel aufgestellten alttestamentarischen Propheten mit Geld aus rechten Kreisen finanziert worden sein.
Die Spenderproblematik ist nicht der einzige Skandal um das Schloss. Von Anbeginn ist es vor allem mit sich selbst beschäftigt. Es eröffnete, als die Debatte um Raubkunst und ihre Restitution einen neuen Höhepunkt erreichte. Eingezogen ins Schloss sind die Sammlung des Ethnologischen Museums und das Museum für Asiatische Kunst – so präsentierte das Humboldt-Forum eine Sammlung, deren Herkunft zum Teil immer noch fragwürdig ist.
Auch der Programmschwerpunkt zum Palast der Republik rief wieder kritische Stimmen auf den Plan. Wenige Tage vor Eröffnung der Ausstellung meldete sich eine Gruppe um Architekturprofessor Philipp Oswalt zu Wort, die die Ausstellung als „Zynismus“ bezeichnete. Aber was zeigt sie und was will die Ausstellung? Die Schau zeigt in multimedialen Installationen und mit 300 Objekten die Palastgeschichte von der Planung und Errichtung über seine Nutzung als Veranstaltungsort, seine politische Rolle bis hin zum Abriss in Zusammenhang mit der Schlossdebatte. Im ersten Raum werden mit wissenschaftlicher Distanz und aus größerer historischer Perspektive viele Fragen gestellt und vor allem Raum gegeben für Antworten des Publikums.
Besucherinnen und Besucher werden dazu aufgerufen, ihre Meinung auf kupferfarbene Wandplatten zu schreiben, die an die Fassade des Palastes erinnern. Die Wand war bereits nach einer Woche Laufzeit der Ausstellung gut gefüllt. Die Meinungen reichen von „Baut den Palast wieder auf“ bis hin zu „Das Wahrzeichen eines Unrechtsstaates“. Im zweiten Raum ist eine abwechslungsreiche und dichte Schau von Objekten zum und aus dem ehemaligen Palast zu sehen, darunter Baupläne und Modelle, originale Kunstwerke und Einrichtungsgegenstände, Geschirr und Kleidung, Videoaufnahmen und Fotografien.
Präsent ist hier zum Beispiel die „Gläserne Blume“ beziehungsweise noch vorhandene Teile davon; eine Glas-Stahl-Plastik, die zum Markenzeichen des Palastes und einem Treffpunkt wurde. Hier wird sie so präsentiert, wie sie im Depot lagert – in einem Holzrahmen eingefasst; ein Schwenk in die Gegenwart.
Auch Unterhaltungskultur und politische Ereignisse im Zusammenhang mit dem Palast werden in Videoaufnahmen oder auf Plakaten und Fotografien gezeigt. Der zentralste Teil der Ausstellung aber ist eine Foto- und Audioinstallation, die Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen hören lässt, die mit dem Palast zu tun hatten; Mitarbeiter, Besucherinnen, Künstlerinnen und Kreative, auch ehemalige Vertragsarbeiter aus anderen Ländern kommen zu Wort.
Wer eine historisch-chronologische Ausstellung und Ostalgie erwartet, ist in einem DDR-Museum besser aufgehoben. Spielerisch gestaltete, partizipative und durchaus sinnliche Medienformate überwiegen in der Ausstellung im Humboldt-Forum – spannende Fragmente, die die Tiefe der Geschichte erahnen lassen und mehrere Perspektiven eröffnen. Hierfür ist das Projekt des Humboldt-Forums auch zu honorieren; die jahrelange Auseinandersetzung mit Expertinnen und Experten, Forschenden und vielen, vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, um möglichst viele Perspektiven auf den Palast einzubringen.
Und dennoch bleibt auch bei dieser Schau das ungute Gefühl, es handelt sich nur um einen Programmpunkt, ein Souvenir. Denn unter der preußisch-christlichen Kuppel eines Schlosses, das anstelle des Palastes gestellt wurde, dessen „Gegenwart“ aufleben zu lassen, kann nur wie ein Widerspruch in sich wirken. Wohl nur mit einer großen Geste, einer konsequenten und permanenten Umsetzung hätte etwas anderes gelingen können.
Was bleibt von der Auseinandersetzung mit der Palastgeschichte und der Erinnerungsarbeit? „Es ist jetzt unsere Aufgabe, uns zu überlegen, wie es mit den Netzwerken weitergeht“, so Anke Schnabel, eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Wenn das Schloss länger steht als der Palast, ist dafür ja noch etwas Zeit.
Die Ausstellung „Hin und weg. Der Palast der Republik ist Gegenwart“ ist noch bis zum 14. Juli im Berliner Humboldt-Forum zu sehen.
„Baut den Palast wieder auf.“
Ausstellungsbesucher
Freie Presse
*Dos Rauschen in Wald hot mir'sch ageta, deß ich mei Haamit net loßen ka!* *Zieht aah dorch onnern Arzgebirg der Grenzgrobn wie ene Kett, der Grenzgrobn taalt de Länder ei, ober onnere Herzen net!* *Waar sei Volk verläßt, daar is net wert, deß'r rümlaaft of daaner Erd!*
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
-

pentium - Beiträge: 53409
- Bilder: 156
- Registriert: 9. Juli 2012, 16:12
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Im Vortext mit dem hier:
„Baut den Palast wieder auf.“ Textauszug ende
Nur wenn der dann wieder steht ist das bestimmt nicht mehr wie früher siehe die "schönen schlanken Menschen." Denn dann latscht mit dir leicht verfetteter EU-Zuwanderer da durch mit einem Anhang von Kindern, wo das deutsche Steuerzahlerherz schon Bocksprünge macht ob deren Unmenge an ausgezahltem Kindergeld. Deren Oma dazu noch im Schlepptau die neben deren Eltern nie wenn überhaupt irgend welche Zahlungen ins deutsche System zu Lebzeiten geleistet hatte. Also besser nicht wieder aufbauen. Aber lasst halt die Erinnerung daran leben.
Rainer Maria
„Baut den Palast wieder auf.“ Textauszug ende
Nur wenn der dann wieder steht ist das bestimmt nicht mehr wie früher siehe die "schönen schlanken Menschen." Denn dann latscht mit dir leicht verfetteter EU-Zuwanderer da durch mit einem Anhang von Kindern, wo das deutsche Steuerzahlerherz schon Bocksprünge macht ob deren Unmenge an ausgezahltem Kindergeld. Deren Oma dazu noch im Schlepptau die neben deren Eltern nie wenn überhaupt irgend welche Zahlungen ins deutsche System zu Lebzeiten geleistet hatte. Also besser nicht wieder aufbauen. Aber lasst halt die Erinnerung daran leben.
Rainer Maria
-

Edelknabe - Grenztruppen
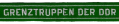
- Beiträge: 19031
- Bilder: 57
- Registriert: 2. Mai 2010, 09:07
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Edelknabe hat geschrieben:Im Vortext mit dem hier:
„Baut den Palast wieder auf.“ Textauszug ende
Nur wenn der dann wieder steht ist das bestimmt nicht mehr wie früher siehe die "schönen schlanken Menschen." Denn dann latscht mit dir leicht verfetteter EU-Zuwanderer da durch mit einem Anhang von Kindern, wo das deutsche Steuerzahlerherz schon Bocksprünge macht ob deren Unmenge an ausgezahltem Kindergeld. Deren Oma dazu noch im Schlepptau die neben deren Eltern nie wenn überhaupt irgend welche Zahlungen ins deutsche System zu Lebzeiten geleistet hatte. Also besser nicht wieder aufbauen. Aber lasst halt die Erinnerung daran leben.
Rainer Maria
Kannst dich beruhigen, man baut den Palast nicht wieder auf. Ist ja auch nur die Meinung eines Ausstellungsbesuchers...Es geht um die Ausstellung....
*Dos Rauschen in Wald hot mir'sch ageta, deß ich mei Haamit net loßen ka!* *Zieht aah dorch onnern Arzgebirg der Grenzgrobn wie ene Kett, der Grenzgrobn taalt de Länder ei, ober onnere Herzen net!* *Waar sei Volk verläßt, daar is net wert, deß'r rümlaaft of daaner Erd!*
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
-

pentium - Beiträge: 53409
- Bilder: 156
- Registriert: 9. Juli 2012, 16:12
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
karnak hat geschrieben:Edelknabe hat geschrieben:Im Vortext mit dem hier:
„Baut den Palast wieder auf.“ Textauszug ende
Nur wenn der dann wieder steht ist das bestimmt nicht mehr wie früher siehe die "schönen schlanken Menschen." Denn dann latscht mit dir leicht verfetteter EU-Zuwanderer da durch mit einem Anhang von Kindern, wo das deutsche Steuerzahlerherz schon Bocksprünge macht ob deren Unmenge an ausgezahltem Kindergeld. Deren Oma dazu noch im Schlepptau die neben deren Eltern nie wenn überhaupt irgend welche Zahlungen ins deutsche System zu Lebzeiten geleistet hatte. Also besser nicht wieder aufbauen. Aber lasst halt die Erinnerung daran leben.
Rainer Maria
Was bist Du nur für ein patriotischer Rassist.Wir werden darauf hoffen müssen, dass von den vielen dicken Kindern wenigstens ein paar zukünftig in die Sozialkassen einzahlen.
Diesen letzten Satz schreibt ein Träumer wie der User karnak.
![Lachen [laugh]](./images/smilies/laugh.gif) Wache endlich auf, Waldmensch......
Wache endlich auf, Waldmensch...... ![Wink [wink]](./images/smilies/wink.gif)
Gruß steffen52
"Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen!"
Friedrich Schiller
Friedrich Schiller
-

steffen52 - Beiträge: 16323
- Bilder: 0
- Registriert: 19. Februar 2015, 21:03
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Leute! Thema ist der Palast der Republik....
*Dos Rauschen in Wald hot mir'sch ageta, deß ich mei Haamit net loßen ka!* *Zieht aah dorch onnern Arzgebirg der Grenzgrobn wie ene Kett, der Grenzgrobn taalt de Länder ei, ober onnere Herzen net!* *Waar sei Volk verläßt, daar is net wert, deß'r rümlaaft of daaner Erd!*
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
-

pentium - Beiträge: 53409
- Bilder: 156
- Registriert: 9. Juli 2012, 16:12
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
pentium hat geschrieben:Leute! Thema ist der Palast der Republik....
Der Ballast der Republik?
![Gluecklich [grins]](./images/smilies/grins.gif)
AZ
"Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist."
„Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war“.
"Es ist manchmal gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. (Voltaire)"
„Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war“.
"Es ist manchmal gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. (Voltaire)"
-

augenzeuge - Flucht und Ausreise

- Beiträge: 95253
- Bilder: 20
- Registriert: 22. April 2010, 07:29
- Wohnort: Nordrhein-Westfalen
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
*Dos Rauschen in Wald hot mir'sch ageta, deß ich mei Haamit net loßen ka!* *Zieht aah dorch onnern Arzgebirg der Grenzgrobn wie ene Kett, der Grenzgrobn taalt de Länder ei, ober onnere Herzen net!* *Waar sei Volk verläßt, daar is net wert, deß'r rümlaaft of daaner Erd!*
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
-

pentium - Beiträge: 53409
- Bilder: 156
- Registriert: 9. Juli 2012, 16:12
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Der Palast der Republik - Erinnerungs Thread
Neu - die Asbest Edition.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
*Dos Rauschen in Wald hot mir'sch ageta, deß ich mei Haamit net loßen ka!* *Zieht aah dorch onnern Arzgebirg der Grenzgrobn wie ene Kett, der Grenzgrobn taalt de Länder ei, ober onnere Herzen net!* *Waar sei Volk verläßt, daar is net wert, deß'r rümlaaft of daaner Erd!*
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
Anton Günther
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e. V.
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/
-

pentium - Beiträge: 53409
- Bilder: 156
- Registriert: 9. Juli 2012, 16:12
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Zurück zu Arbeiten und Freizeitgestaltung
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast







